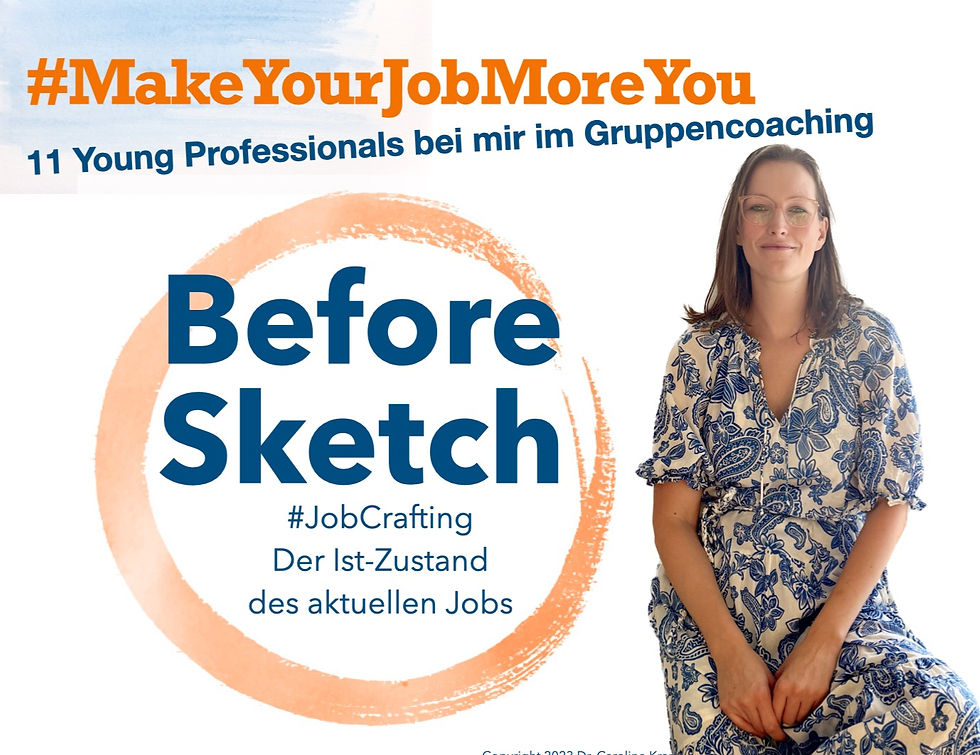Das Forschungsprojekt
- info@carolinekranabetter.com

- 20. Apr. 2023
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 25. Apr. 2023

Mit dem Gruppencoaching lebe ich nicht nur meine Leidenschaften fürs Coachen und Designen von Entwicklungsreisen, sondern möchte auch Antworten näherkommen, die mich schon länger aus wissenschaftlicher und praktischer Perspektive beschäftigen.
Zuallererst bewegt mich, wie Menschen selbst aktiv werden und ihre Arbeit so gestalten können, dass sie gut zu ihnen passt, zu ihren Stärken, Interessen und Bedürfnissen. So dass sie das Leben leben, das ihnen entspricht. #DasWesentliche #Ganzheitlichkeit
Gerade durch die Pandemie und das virtuelle und hybride Arbeiten entstanden und bestehen erhöhte Anforderungen an die Selbstführung. Und vielleicht gilt das besonders für Young Professionals (YP), die noch im ersten Job und der Arbeitswelt ankommen. Nora Dietrich bringt es auf den Punkt: Während multipler globaler Krisen mussten sie eine steile Lernkurve im Job hinlegen - und das remote arbeitend. Implizite Regeln erfühlen, transaktionale Meetings statt persönlicher Zwischengespräche, keine kurzen Wege, kaum von Anderen durch Beobachten lernen. Wie soll da ein unterstützendes Netzwerk entstehen, soziales Kapital aufgebaut werden?
Bei so manchen YP zeigt sich Unzufriedenheit oder Überlastung als Ergebnis.
Also, was tun? #Jobwechsel, #quietquitting oder #jobcrafting?
Diejenigen, die sich für Job Crafting entscheiden, gestalten aktiv ihre aktuelle Arbeit. Aus der Forschung wissen wir, dass das mit höherer Motivation und Leistung zusammenhängt (z.B. Rudolph, Katz, Lavigne, & Zacher, 2017). Natürlich birgt Job Crafting auch Risiken und Nebenwirkungen, wie es nun mal immer der Fall ist, wenn wir etwas verändern, doch davon erzähle ich ein anderes Mal.
Bisherige Interventionen, also Trainings oder Workshops, die Job Crafting lehren und fördern, setzen ihren Fokus auf das Analysieren des aktuellen Jobs, das Neugestalten des Jobs (erstmal auf dem Papier) und unterstützen bei der Planung der Umsetzung.
Wir wissen aber auch - aus der Wissenschaft und aus dem eigenen Leben: Ein bewusster Vorsatz bewirkt noch keine nachhaltige Änderung (Pullen, 2019).
Da stellten sich mir folgende Fragen:
Wie können sich Menschen stimmige Ziele beim Craften setzen, die ihre bewussten und unbewussten Anteile integrieren? Oft sind uns unsere Bedürfnisse wenig bewusst und manchmal unbewusst….
Wie können sie diese Ziele so formulieren und verinnerlichen, dass die Ziele handlungswirksam sind und nachhaltig motivieren?
An diesen Selbststeuerungsprozessen, dem Erreichen von Zielen mit allem, was dafür nötig ist, sind neuronale Prozesse unterhalb der Bewusstseinsschwelle beteiligt. Diese Prozesse laufen nur dann (langfristig und ganzheitlich) erfolgreich ab, wenn wir unser Unbewusstes, das neuronale Korrelat unseres emotionalen Erfahrungsgedächtnisses, einbeziehen. In diesem sind unsere relevanten Erfahrungen mit ihren zugehörigen Bildern, Worten, Sinneseindrücken, Gefühlen gespeichert. Dieser Erfahrungsspeicher gibt uns Hinweise darauf, was uns gut tut und wovor wir uns besser hüten. Wir können es also auch unsere gesammelte Lebensweisheit nennen oder Intuition oder Bauchgefühl - es spricht nämlich nicht in Gedanken zu uns, sondern über Gefühle und Körperempfindungen.
Was gilt es jetzt zu tun? Hierzu ein Beispiel frei nach Maja Storch: Ruth setzt sich das Ziel, öfter Nein zu sagen und Grenzen bei der Arbeit zu setzen. Es gelingt ihr aber nicht, dieses Ziel umzusetzen, obwohl sie absolut davon überzeugt ist, dass es das „Richtige“ ist. Was blockiert sie also? Die Formulierung des Ziels mit den Worten „Nein“ und „Grenzen“ erfährt in Ruths Unbewussten, ihrem emotionalen Erfahrungsgedächtnis, keine Zustimmung - die Zielformulierung weckt negative Assoziationen davon, Menschen zu verprellen, in ihr steigen Bilder auf von Grenzzäunen und Grenzsoldaten. Ruth gelingt ihr Vorhaben, indem sie ihr Ziel anders rahmt und Bilder und Assoziationen weckt, zu denen auch ihr Unbewusstes „Ja“ sagt: „Ich sage „ja“ zu einem pünktlichen Feierabend mit meinen Freunden und meinen Hobbys.“ Mit dieser Botschaft kann sie bei der Arbeit ins Gespräch darüber gehen, aus welchem Grund sie beispielsweise ihre Arbeit für heute beendet.
Wie kommen wir mit dem Unbewussten, unseren Bedürfnissen und Motiven in Kontakt? Unser emotionales Erfahrungsgedächtnis äußert sich über somatische Marker (Damasio, 1994) und gibt so uns Hinweise. Das berühmte glückliche Grinsen oder ein freudiges Kribbeln in den Finger als positiver somatischer Marker —> „Hin zu“, mehr davon!
Der Kloß im Hals oder ein Krampf im Magen, verspannte Schultern als negative somatische Marker —> „Weg von“, das nicht!
Unsere Körper sind Ressourcen für stimmige Entscheidungen und Lösungen. Es empfiehlt sich allerdings, nicht allein die somatischen Marker bestimmen lassen, sondern in ein Wechselspiel zwischen Denken und Spüren einzutreten!
Im Gruppencoaching erkunden und verändern die Teilnehmenden ihre mentalen Bilder und kommunizieren achtsam mit ihrem Körper, dem Sprachrohr des emotionalen Erfahrungsgedächtnisses. Sie verknüpfen ihr bewusstes und unbewusstes Wissen auf ihrem Weg in Richtung ihres Ziels.
Mal angenommen, das funktioniert bisher alles ganz wunderbar, die Teilnehmenden setzen sich stimmige und motivierende Ziele - was passiert dann? Die meisten Trainings und Workshops sind mit der Planung des Transfers abgeschlossen. Es gibt max. noch einen Fragebogen zur Evaluation und wir als Begleiter:innen wissen meist nicht, was umgesetzt werden konnte. Ich möchte aber wissen: Was war hilfreich? Kamen die Teilnehmenden ihren Zielen näher? Tritt das gewünschte Erleben ein, das sie oft formulieren als Sinnerleben, Erfüllung, Zufriedenheit bei der Arbeit? Welche Entwicklungslinien zeichnen sich ab? Soll ich es in der nächsten Runde als Trainerin und Coach genauso wiederholen? Deswegen möchte ich im Forschungsprojekt nach dem letzten persönlichen Kontakt meine Teilnehmenden weiter eng begleiten und lernen, wie die Umsetzung lief und verstehen, was hinderlich, was förderlich war.
Die Erfahrungen der YP geben uns außerdem erste Ideen über Handlungsfelder in Unternehmen, wenn sie Job Crafting fördern wollen: Welchen Unterschied macht die Qualität der Beziehung zur Führungskraft? Wie kann Unterstützung durch das Team funktionieren? Teilen die YP überhaupt bei der Arbeit, was sie verändern wollen? An welchen Strukturen scheitern Gestaltungsversuche? Welche Gestaltungsmöglichkeiten finden die YP? Was können wir aus ihren Erfahrungen für eine Unternehmenskultur lernen, die aktiv zum Gestalten einlädt? Das Signalisieren von Offenheit für Job Crafting ist übrigens ein Faktor für die Gewinnung von Fachkräften laut eines brandneuen Artikel von Jens Schüler und Kolleg:innen!
Was ist dann zusammengenommen mein Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion und für die Community der Praktiker:innen?
Job Crafting unter der Lupe: Illustration der Bedürfnisse/Motive/Stärke, nach denen die YP streben, mögliche Entwicklungslinien/-wege, hinderliche und förderliche Faktoren auf ihrem Weg - im Innen und Außen.
Methodische Impulse: Konkrete und erprobte Ansätze, wie sich unbewusste und bewusste Anteile, kognitive und körperorientierte Methoden im Gruppencoaching zum Thema Job Crafting verbinden lassen #evidencebasedpractice
Literatur
Damasio, A. R. (1994). Descartes’ Irrtum: Fühlen. Denken und das menschliche Gehirn, List, München, 85(4).
Pullen, J. C. (2016). Der Körper als Ressource in individuellen Veränderungsprozessen. Organisationsberatung, Supervision, Coaching, 3(23), 285-296.
Rudolph, C. W., Katz, I. M., Lavigne, K. N., & Zacher, H. (2017). Job crafting: A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes. Journal of vocational behavior, 102, 112-138.
Schüler, J., Franzke, S., Boehnlein, P., & Baum, M. (2023). Do job crafting opportunities help to win talent? Disentangling and contextualizing the effects of job crafting opportunities on applicant attraction. Journal of Organizational Behavior.